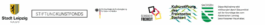Erinnerung als höchste Form des Vergessens
AKT III – Ausstellung und Programm
1. März – 30. April 2025
Ausstellung von Ute Richter mit einer Performance von Angelika Waniek und künstlerischen Beiträgen von Max Baitinger, Mandy Gehrt, Juliane Jaschnow, Susanne Keichel und Ipke Starke und dem Slacknetz Leipzig e.V.
->Dokumentation Programm
Ausstellung:






















image: Anna Sophie Knobloch
Wie kann Erinnerungskultur aussehen, die nicht zu ritualisierten Gesten erstarrt? Welche Formen des Erinnerns ermöglichen einen emphatischen Bezug und eine Resonanz für die Gegenwart, die auch die heutigen Kontinuitäten lesbar macht?
Das dreiteilige Kunstprojekt „Erinnerung als höchste Form des Vergessens” zeigt Ergebnisse künstlerischer Arbeitsprozesse zur Erinnerungspolitik und bietet einen Gesprächsraum, um historische und aktuelle Formen öffentlichen Erinnerns zu reflektieren und deren Symbolik zu hinterfragen.
Die Dramaturgie des Projekts umfasst drei Akte an verschiedenen öffentlichen Orten in Leipzig und befragt die politischen, sozialen und zeitlichen Kontexte von Gedenkorten und -praxen. Dabei untersucht das Projekt antifaschistisches Gedenken als ideologische, aber oberflächliche Setzung in der DDR im Verhältnis zur heutigen Bedeutung von zivilgesellschaftlich getragener Erinnerungskultur. Wird staatliche Gedenkkultur instrumentalisiert, um vorwiegend entlastende oder legitimierende Funktionen zu erfüllen, korrumpiert dies die Erinnerungspraxis und steht einer wirklichen Aufarbeitung fortbestehender faschistischer Kontinuitäten im Weg. Entsprechend kommentiert auch das titelgebende Zitat des Historikers Eike Geisel Formen des Gedenkens in Deutschland als „höchste Form des Vergessens“ und thematisiert Widersprüche und Instrumentalisierungen von Erinnerungskultur.
Neben der Beschäftigung mit den Auswirkungen der historischen erinnerungspolitischen Praxis der DDR werden in der Ausstellung künstlerische Strategien des Erinnerns und aktuelle Formen des antifaschistischen Gedenkens beleuchtet, die die Aktualität der Geschichte und ihre stetige Neubewertung mit in den Blick nehmen.
Der dritte Akt von „Erinnerung als höchste Form des Vergessens“ befragt im Ausstellungsraum IDEAL und im anschließenden Stadtraum Träger von Erinnerung und Zeug*innenschaft und fragt nach der Resonanz von Erinnerungsorten, Objekten, Denkmälern und Ritualen in der Gegenwart. Wie erschließt man die Aktualität des zu Erinnernden und macht dessen heutige Kontinuitäten lesbar? Wie ist der Erinnerungsträger selbst in der Gegenwart in seinen politischen, sozialen und zeitlichen Kontexten eingebettet?
Akt I - Vortrag: Felicitas Kübler „Vom Abwerfen und Erfahren der Vergangenheit: Ein widersprüchliches Modell des Gedenkens”
Moderation: Nanne Buurman
Performance : Angelika Waniek „Abwurfstelle: Many happy returns“
November 2024 Stadtbibliothek Leipzig
Kübler thematisierte in ihrem Vortrag verschiedene Formen der Erinnerungskultur und analysierte diese als „leere” Formen des Erinnerns, die als Phänomene kapitalistischer Vergesellschaftung gelesen werden müssen. Dabei skizzierte sie Vorschläge für eine Erinnerungspraxis als Möglichkeit einer gegenwärtigen Gesellschaftskritik. Das anschließende Gespräch mit Nanne Buurmann kreiste u.a. um die Orte und die Sichtbarkeit des Erinnerns in der Öffentlichkeit und die Performanz des Erinnerns. Wie hält man das Erinnern lebendig? In ihrer Performance setzte Angelika Waniek den Rahmen für die theoretischen Inhalte, indem sie die Stadtbibliothek selbst als Gedenkort markierte und Symbole und Gesten von Erinnerungskultur hinterfragte.
AKT II
Intervention / Banner-Performance: Ute Richter und Angelika Waniek mit dem Slacknetz Leipzig e.V.
Januar 2025, öffentlicher Raum vor dem Industriedenkmal Stelzenhaus in Leipzig-Plagwitz.
Ein Banner bewegte sich über den Karl-Heine-Kanal. “Antifaschismus taugt nicht als Denkmal” war auf ihm zu lesen. An ihm vorbei, in gleicher Höhe, balancierten Menschen auf einer Highline, einem Seil, das fast zwölf Meter über dem Kanal und gut 100 Meter lang gespannt ist. Die Intervention am Stelzenhaus, das auch ein Erinnerungsort an die Zwangsarbeit während der NS-Zeit ist, wurde zusammen mit dem Slacknetz Leipzig e.V. organisiert, die dort an den Wochenenden trainieren. Im Kontext dieser urbanen Praxis, den städtischen Raum spielerisch zu nutzen, bricht die Aktivierung des Banners mit Gesten von Demonstrationen und politischen Forderungen und inszeniert es als widerspenstigen Protagonisten der Performance. Visuell verwies die Aktion auf die offiziellen politischen Losungen der DDR im öffentlichen Raum, während der Slogan in seiner Ambivalenz Widersprüche von Erinnerungspolitik thematisierte.
Termine:
16. März
16 Uhr: Ausstellungseröffnung im IDEAL
16:30 Uhr: Performance von Angelika Waniek und Inga Martel
05.April.
14 Uhr: Stadtteilführung Stelzenhaus durch die Gedenkstätte für Zwangsarbeit
24. April
17 Uhr: Performance von Angelika Waniek und Inga Martel in Kooperation mit der Ausstellung „Partizan★ke Art“ in der HGB Leipzig
26. April
18 Uhr: Künstlerinnengespräch mit Mandy Gehrt im Pögehaus
30. April
19 Uhr: Gespräch mit den Kurator*innen und den Beteiligten Künstler*innen im IDEAL
->Dokumentation Programm
Arbeiten in der Ausstellung:
Rauminstallation – Erinnerung als höchste Form des Vergessens
Ute Richter in Zusammenarbeit mit Juliane Jaschnow und Ipke Starke
Banner, Antifaschismus taugt nicht als Denkmal, 30 x 3 m
Material, A0 Prints, 2020-24
Zeichnungen aus der Serie “liegen”, 2023
Video I / Juliane Jaschnow
Videoprojektion, HD, 5′34″, Loop
Kamera und Montage: Juliane Jaschnow
1. Kamera: Clara Wieck
Klang / Ipke Starke
Stereo, 5′34″, Loop
Video II / Juliane Jaschnow
Monitor, Leseschleife, 4K, 1′49″
Banner-Performance, Januar 2025
Intervention am Stelzenhaus Leipzig-Plagwitz von Ute Richter und Angelika Waniek in Kooperation mit dem Slacknetz Leipzig e.V.
Wie kann Erinnerungskultur aussehen, die nicht zu ritualisierten Gesten erstarrt, um vorgeschriebenen städtischen, staatlichen oder politischen Protokollen zu folgen, und die keine Kranzniederlegungen und Gedenktafeln generiert? Eine Frage der urbanen und kulturellen Praxis. Die Behauptung „Antifaschismus taugt nicht als Denkmal“ entstand beim Hören einer Radiosendung über das Werk des jüdischen Dichters Paul Celan, das von seiner unmittelbaren Erfahrung mit Gewalt, Verfolgung und Tod im Faschismus geprägt ist. Sie ist ein dialektischer Blick auf eine aktuelle Gedenkkultur, die mit repräsentativen Gesten an offiziellen Gedenktagen medienwirksame Bilder produziert.
Das raumgreifende Banner zitiert visuell die offiziellen politischen Losungen der DDR im öffentlichen Raum, die auf überdimensionierten großen Transparenten einen politisch sanktionierten Antifaschismus propagierten. Inhaltlich thematisiert der Slogan in seiner Ambivalenz Widersprüche von Erinnerungspolitik. Der Satz auf dem 30m langen Banner ist in der Schrift Super Grotesk gesetzt. 1928 wurde sie von Arno Drescher entworfen. Er war 1940–45 auch Rektor der Leipziger Kunsthochschule. Die Super Grotesk war zusammen mit der Maxima eine der am häufigsten verwendeten Schriften in der DDR. Mit ihr wurden im „Neuen Deutschland“ – dem „Zentralorgan der SED“ von 1946 bis 1989 – die täglichen politischen Losungen des real existierenden Sozialismus gesetzt.
Der öffentliche Raum über dem Karl-Heine-Kanal am Stelzenhaus im ehemaligen Industriegebiet Leipzig-Plagwitz wird vom Slacknetz Leipzig e.V. für Balanceakte genutzt. An den Wochenenden kann man die Slackliner dort beim Training sehen und über ihre Kunststücke staunen. Diese urbane Praxis, den städtischen Raum spielerisch zu nutzen, hat auch für Vorbeigehende Unterhaltungswert. Die Aktivierung des Banners in diesem Kontext bricht mit Gesten von Demonstrationen und politischen Forderungen und gewinnt durch die artistische Leichtigkeit der Bewegungen auf der Slackline.
Das Stelzenhaus selbst ist als Industrie-Denkmal auch ein Erinnerungsort an die Zwangsarbeit während der NS-Zeit. Um die Kapazitäten für die Rüstungsproduktion der Verzinkerei Grohmann & Frosch zu erweitern, wurde im Industriegebiet Leipzig Plagwitz eine neue Halle gebraucht. Aus Platzmangel entstand 1937–39 die auf Stelzen errichtete Lagerhalle am ausgehobenen Karl-Heine-Kanal. Das Unternehmen produzierte im 2. Weltkrieg unter anderem das Panzerschutzschild „Siegfried“. Für die Produktion wurden Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene eingesetzt. Das titelgebende Zitat des Historikers Eike Geisel kommentiert Formen des Gedenkens in Deutschland als „höchste Form des Vergessens“ und thematisiert Widersprüche und Instrumentalisierungen von Erinnerungskultur.
aufknoten/aufmerken, sich wieder verbinden
Angelika Waniek und Inga Martel
Performance / 16. März + 24. April
aufknoten/aufmerken, sich wieder verbinden ist eine Recherche zur Zeitzeugenschaft im öffentlichen Raum, eine performative Situation in der Nachbarschaft von Pflanzen. Dabei blickt die Performerin Angelika Waniek zusammen mit Inga Martel, Künstlerin und somatisch Forschende, auf individuelle Lebensgeschichten, subjektive Erfahrungen, Pflanzen und ihre Spuren. Die Zeit, die bezeugt wird, ist die des Nationalsozialismus. Die Zeug*innen sind diejenigen, gegen die sich die Gewalt im Nationalsozialismus richtete, aber auch Bäume als vermeintlich stumme Zeugen, denen sich Waniek und Martel zuneigen. Zwei davon stehen in unmittelbarer Nähe des Kunstraums IDEAL und der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Orte, denen die Künstlerinnen verbunden sind.
16.März // 16.30 Uhr Kunstraum IDEAL
aufknoten, sich wieder verbinden
Der Kunstraum IDEAL befindet sich auf dem ehemaligen Werksgelände des Unternehmens Clemens Humann. Eine Metallfabrik, die während der Zeit des Zweiten Weltkrieges Zuliefererbetrieb für die Rüstungsindustrie war, besonders für den Flugzeugbau. Dabei waren auch Zwangsarbeiter:innen im Einsatz, vor allem aus der Sowjetunion, Frankreich, Spanien, Estland, Belgien, Italien, Kroatien und dem Protektorat Böhmen und Mähren. Quelle: Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig (www.zwangsarbeit-in-leipzig.de/karte)
24.April // 17 Uhr Hochschule für Grafik und Buchkunst
aufmerken, sich wieder verbinden
Die Performance in der Nähe der HGB findet statt in Kooperation mit der Ausstellung “Partizan★ke Art – Die Kunst des weiblichen Widerstands in Jugoslawien und Kärnten”, die den Fokus auf den bis heute wenig sichtbaren weiblichen Widerstand gegen die deutsche Besatzungsgewalt und die Achsenmächte in Jugoslawien legt.
Book to head
Max Baitinger
Billboard
Max Baitingers Comic ist eine erzählerische Dekonstruktion einiger Sekunden im Leben Victor Klemperers: In Dresden schlägt ihm Johannes Clemens, Mitglied der SS, das Buch „Der Mythos des 20. Jahrhunderts“ auf den Kopf. Die Symbolik, dass ein jüdischer Professor von einem SS-Mitglied mit der Nazi-Ideologie geschlagen wird, wird auf den dreißig Seiten des Comics auseinandergenommen. Baitinger folgt erzählerischen Fäden, die durch das Leben des Protagonisten führen, um einer stumpfen, aber aussagekräftigen Anekdote Tiefe zu verleihen. Für den Ideal Art Space wurde das ursprüngliche Heft von 2017 zu einer Billboard-Collage neugeordnet. Victor Klemperer (1881 – 1960) ist bekannt für seine Tagebücher über seine Jahre im Nationalsozialismus, die er mit seiner nicht-jüdischen Frau Eva in Dresden verbrachte.
geb. 7. Oktober 1977, Alexandria, gest. 1. Juli 2009, Dresden (ein Kommentar)
Susanne Keichel
Posterserie im Stadtraum
Die Fotografin Susanne Keichel zeigt in dieser Arbeit aus der Perspektive einer Anwesenden die Gedenkfeiern für die Ägypterin Marwa Ali El-Sherbini. Sie war eine ägyptische Handballnationalspielerin und Pharmazeutin, die als Zeugin eines Strafprozesses aus islam- und ausländerfeindlichen Motiven im Jahr 2009 in Dresden im Gerichtssaal von dem Angeklagten des Prozesses erstochen wurde. Der Gewaltakt im Gerichtssaal begründete eine Diskussion um die Sicherheit an den Gerichten und eine Gedenkkultur für das Opfer in Dresden. Die schnappschussartigen Bildausschnitte bewegen sich ästhetisch zwischen Privataufnahme und Pressefoto und erinnern daran, dass es sich hier nicht um Fiktion handelt. Sie dokumentieren Momente, ein Gefühl der Betroffenheit und Ohnmacht angesichts einer Tat, die vor den Augen aller stattfand.
Die fotografische Arbeit wurde für diese Ausstellung als Plakatedition bearbeitet und ist neben der Präsentation am IDEAL auch im Stadtraum verteilt.
Mapping a Memory
Mandy Gehrt
Gespräch über ein künstlerisches Archivprojekt / 26. April
Mandy Gehrt setzt sich in ihrer Arbeit mit Formen des Erinnerns und Bewahrens, Kulturen des Gedenkens sowie der Konstruktion von Geschichte auseinander. Sie interessiert sich sowohl für private Sammlungen und Erzählungen als auch für Archivierungspraktiken und kollektive Gedenkrituale. Mit ihrem künstlerischen Archivprojekt verfolgt sie das Ziel, die individuellen Erinnerungen ungarisch-jüdischer Holocaustüberlebender zu kartieren, die im KZ-Außenlager von Buchenwald in Markkleeberg (Landkreis Leipzig) zur Zwangsarbeit verpflichtet wurden.
In dem Gespräch wird Mandy Gehrt Einblicke in ihre Recherchen in Deutschland, Ungarn und New York geben, bei denen sie die Lebenswege der Überlebenden bis nach New York dokumentierte und Verbindungen zu Archiven und Museen untersuchte. In diesem Zusammenhang besuchte sie auch die Familien der Überlebenden und erforschte deren individuelle Erinnerungspraxen.
Beteiligte
Ute Richter, *1964 in Dresden, arbeitet als Bildende Künstlerin interdisziplinär mit Installation, Video, urbaner Intervention und Zeichnung. Ihre künstlerischen Recherchen entwickelt sie im Kontext von Alltag, Architektur, urbanem Raum und Erinnerung. Ihr Werk umfasst ortsspezifische Installationen im öffentlichen Raum. Die künstlerische Arbeit begreift sie als gesellschaftliches Handeln. Von 1986–91 studierte sie an der HfBK Dresden, lebte von 1992–98 in Paris, seit 2005 in Leipzig.
www.ute-richter.de
Angelika Waniek, bildende Künstlerin und Performerin lebt und arbeitet in Leipzig. Sie blickt auf eine langjährige künstlerische Auseinandersetzung und Erarbeitung von ortsspezifischen performativen Situationen u.a. zu deutsch-deutschen, auch transnationalen Themen der Erinnerungskultur, Gedenk- und Heilungsprozessen und darin die Verbindungen zwischen gesellschaftlichen und biografischen Ereignissen und deren Bewahrung in Archiven. Lehraufträge u.a. an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (Leipzig), Burg Giebichenstein (Halle), Muthesius Kunsthochschule (Kiel).
www.lea.hotglue.me/
Juliane Jaschnow ist Künstlerin und Filmemacherin. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind zeitgenössische und historische Bildpolitiken sowie kollektive Narrative, Erinnerungsprozesse und deren identitätsstiftende Dimension. Sie hatte Residenzaufenthalte an der Cité internationale des arts Paris und Akademie Schloss Solitude, war Teilnehmerin an der PMMC/Lab der Werkleitz Gesellschaft. Sie ist Teil der Filmischen Initiative Leipzig (FILZ).
www.julianejaschnow.de/
Ipke Starke studierte Musik in Leipzig und Paris und arbeitete anschließend als Assistent für computergestützte Komposition am IRCAM in Paris. Seit 2000 Professur für Tonsatz und Elektroakustische Komposition an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Von 2016 bis 2024 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Elektroakustische Musik (DEGEM). Künstlerische Arbeiten für instrumentale Besetzungen, elektroakustische Medien, genreüberschreitende und interdisziplinäre Projekte.
Max Baitinger wurde 1982 in Penzberg geboren. Er absolvierte eine Schreinerausbildung und studierte Illustration an der HGB Leipzig. Er war Mitorganisator des Internationalen Comic- und Grafikfestivals „The Millionaires Club“ und arbeitet als freischaffender Illustrator, verfasst Graphic Novels und Zines. Seine Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Für „Sibyl-la“ wurde ihm der Comicbuchpreis der Berthold Leibinger Stiftung verliehen.
www.maxbaitinger.com
Susanne Keichel studierte nach einer Ausbildung zur Fotografin bei Stefan Thurmann in Hamburg, an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und schloss ihr Studium als Meisterschülerin bei Prof. Tina Bara ab. Gesellschaftliche und politische Entwicklungen und deren Auswirkungen über längere Zeiträume stehen im Zentrum von Susanne Keichels Arbeit. Ein starker Fokus liegt dabei auf dem Weggehen und Ankommen von Menschen in einer globalisierten Welt und auf der sozialen Ungleichheit, die unsere Gesellschaft reproduziert.
https://www.susannekeichel.de/
Inga Martel, bildende Künstlerin, und Performerin lebt und arbeitet in Leipzig und in Island. Als Somatic Movement Educator für Body-Mind Centering® arbeitet sie im Bereich Körperforschung und somatischer Erfahrbarkeit.
Als Gründerin des Laboratoriums für Somatisches Erforschen: Einen Raum für potenziale Entfaltung, Embodyment und Achtsamkeit, vermittelt sie Ursang — intuitives Tönen, begleitet und verbindet Menschen mit ihren Körper- und Stimmlandschaften.
Mandy Gehrt erforscht in ihrer künstlerischen Arbeit Prozesse des Erinnerns und Bewahrens sowie die Konstruktion von Geschichte. Sie interessiert sich für private und kollektive Narrative, Archivierungspraktiken und Gedenkkulturen. Dabei verbindet sie persönliche Erzählungen mit materiellen und immateriellen Spuren der Vergangenheit, untersucht, wie Erinnerung durch Objekte, Dokumente und Rituale geformt wird, und hinterfragt gesellschaftliche Mechanismen des Gedenkens.
Der Slacknetz Leipzig e.V. vereint engagierte Sportlerinnen und Sportler mit einer gemeinsamen Leidenschaft für das Slacklinen, insbesondere das anspruchsvolle Highlinen in Parks, urbanen Räumen und natürlichen Landschaften. Der Verein fördert den Sport in Leipzig, Deutschland und international und engagiert sich für dessen nachhaltige Entwicklung.
www.slacknetzleipzig.de
Die Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig erinnert an die Opfer und Folgen des NS-Zwangsarbeitseinsatzes. Sie dient als Anlaufstelle für Betroffene, erforscht unbeleuchtete Aspekte und sammelt historische Zeugnisse. Öffentliche Veranstaltungen, Führungen, Stadtteilrundgänge und Bildungsprogramme ergänzen die Ausstellung am Standort der HASAG, Sachsens größtem Rüstungsbetrieb.
_____________
Das dreiteilige Ausstellungsprojekt ist in enger Zusammenarbeit von Ute Richter mit Angelika Waniek, Clara Hofmann und Gregor Peschko entwickelt worden. Die Grafik des Projektes und das Banner wurden mit den Grafiker:innen Nelly Nakahara und Gerrit Brocks umgesetzt.
Mit freundlicher Unterstützung von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, dem Kulturamt der Stadt Leipzig, der Stiftung Kunstfonds, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und dem sächsischen Förderprogramm Sehnsucht nach Freiheit. Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.
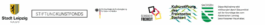
Erinnerung als höchste Form des Vergessens
AKT III – Ausstellung und Programm
1. März – 30. April 2025
Ausstellung von Ute Richter mit einer Performance von Angelika Waniek und künstlerischen Beiträgen von Max Baitinger, Mandy Gehrt, Juliane Jaschnow, Susanne Keichel und Ipke Starke und dem Slacknetz Leipzig e.V.
->Dokumentation Programm
Ausstellung:






















image: Anna Sophie Knobloch
Wie kann Erinnerungskultur aussehen, die nicht zu ritualisierten Gesten erstarrt? Welche Formen des Erinnerns ermöglichen einen emphatischen Bezug und eine Resonanz für die Gegenwart, die auch die heutigen Kontinuitäten lesbar macht?
Das dreiteilige Kunstprojekt „Erinnerung als höchste Form des Vergessens” zeigt Ergebnisse künstlerischer Arbeitsprozesse zur Erinnerungspolitik und bietet einen Gesprächsraum, um historische und aktuelle Formen öffentlichen Erinnerns zu reflektieren und deren Symbolik zu hinterfragen.
Die Dramaturgie des Projekts umfasst drei Akte an verschiedenen öffentlichen Orten in Leipzig und befragt die politischen, sozialen und zeitlichen Kontexte von Gedenkorten und -praxen. Dabei untersucht das Projekt antifaschistisches Gedenken als ideologische, aber oberflächliche Setzung in der DDR im Verhältnis zur heutigen Bedeutung von zivilgesellschaftlich getragener Erinnerungskultur. Wird staatliche Gedenkkultur instrumentalisiert, um vorwiegend entlastende oder legitimierende Funktionen zu erfüllen, korrumpiert dies die Erinnerungspraxis und steht einer wirklichen Aufarbeitung fortbestehender faschistischer Kontinuitäten im Weg. Entsprechend kommentiert auch das titelgebende Zitat des Historikers Eike Geisel Formen des Gedenkens in Deutschland als „höchste Form des Vergessens“ und thematisiert Widersprüche und Instrumentalisierungen von Erinnerungskultur.
Neben der Beschäftigung mit den Auswirkungen der historischen erinnerungspolitischen Praxis der DDR werden in der Ausstellung künstlerische Strategien des Erinnerns und aktuelle Formen des antifaschistischen Gedenkens beleuchtet, die die Aktualität der Geschichte und ihre stetige Neubewertung mit in den Blick nehmen.
Der dritte Akt von „Erinnerung als höchste Form des Vergessens“ befragt im Ausstellungsraum IDEAL und im anschließenden Stadtraum Träger von Erinnerung und Zeug*innenschaft und fragt nach der Resonanz von Erinnerungsorten, Objekten, Denkmälern und Ritualen in der Gegenwart. Wie erschließt man die Aktualität des zu Erinnernden und macht dessen heutige Kontinuitäten lesbar? Wie ist der Erinnerungsträger selbst in der Gegenwart in seinen politischen, sozialen und zeitlichen Kontexten eingebettet?
Akt I - Vortrag: Felicitas Kübler „Vom Abwerfen und Erfahren der Vergangenheit: Ein widersprüchliches Modell des Gedenkens”
Moderation: Nanne Buurman
Performance : Angelika Waniek „Abwurfstelle: Many happy returns“
November 2024 Stadtbibliothek Leipzig
Kübler thematisierte in ihrem Vortrag verschiedene Formen der Erinnerungskultur und analysierte diese als „leere” Formen des Erinnerns, die als Phänomene kapitalistischer Vergesellschaftung gelesen werden müssen. Dabei skizzierte sie Vorschläge für eine Erinnerungspraxis als Möglichkeit einer gegenwärtigen Gesellschaftskritik. Das anschließende Gespräch mit Nanne Buurmann kreiste u.a. um die Orte und die Sichtbarkeit des Erinnerns in der Öffentlichkeit und die Performanz des Erinnerns. Wie hält man das Erinnern lebendig? In ihrer Performance setzte Angelika Waniek den Rahmen für die theoretischen Inhalte, indem sie die Stadtbibliothek selbst als Gedenkort markierte und Symbole und Gesten von Erinnerungskultur hinterfragte.
AKT II
Intervention / Banner-Performance: Ute Richter und Angelika Waniek mit dem Slacknetz Leipzig e.V.
Januar 2025, öffentlicher Raum vor dem Industriedenkmal Stelzenhaus in Leipzig-Plagwitz.
Ein Banner bewegte sich über den Karl-Heine-Kanal. “Antifaschismus taugt nicht als Denkmal” war auf ihm zu lesen. An ihm vorbei, in gleicher Höhe, balancierten Menschen auf einer Highline, einem Seil, das fast zwölf Meter über dem Kanal und gut 100 Meter lang gespannt ist. Die Intervention am Stelzenhaus, das auch ein Erinnerungsort an die Zwangsarbeit während der NS-Zeit ist, wurde zusammen mit dem Slacknetz Leipzig e.V. organisiert, die dort an den Wochenenden trainieren. Im Kontext dieser urbanen Praxis, den städtischen Raum spielerisch zu nutzen, bricht die Aktivierung des Banners mit Gesten von Demonstrationen und politischen Forderungen und inszeniert es als widerspenstigen Protagonisten der Performance. Visuell verwies die Aktion auf die offiziellen politischen Losungen der DDR im öffentlichen Raum, während der Slogan in seiner Ambivalenz Widersprüche von Erinnerungspolitik thematisierte.
Termine:
16. März
16 Uhr: Ausstellungseröffnung im IDEAL
16:30 Uhr: Performance von Angelika Waniek und Inga Martel
05.April.
14 Uhr: Stadtteilführung Stelzenhaus durch die Gedenkstätte für Zwangsarbeit
24. April
17 Uhr: Performance von Angelika Waniek und Inga Martel in Kooperation mit der Ausstellung „Partizan★ke Art“ in der HGB Leipzig
26. April
18 Uhr: Künstlerinnengespräch mit Mandy Gehrt im Pögehaus
30. April
19 Uhr: Gespräch mit den Kurator*innen und den Beteiligten Künstler*innen im IDEAL
->Dokumentation Programm
Arbeiten in der Ausstellung:
Rauminstallation – Erinnerung als höchste Form des Vergessens
Ute Richter in Zusammenarbeit mit Juliane Jaschnow und Ipke Starke
Banner, Antifaschismus taugt nicht als Denkmal, 30 x 3 m
Material, A0 Prints, 2020-24
Zeichnungen aus der Serie “liegen”, 2023
Video I / Juliane Jaschnow
Videoprojektion, HD, 5′34″, Loop
Kamera und Montage: Juliane Jaschnow
1. Kamera: Clara Wieck
Klang / Ipke Starke
Stereo, 5′34″, Loop
Video II / Juliane Jaschnow
Monitor, Leseschleife, 4K, 1′49″
Banner-Performance, Januar 2025
Intervention am Stelzenhaus Leipzig-Plagwitz von Ute Richter und Angelika Waniek in Kooperation mit dem Slacknetz Leipzig e.V.
Wie kann Erinnerungskultur aussehen, die nicht zu ritualisierten Gesten erstarrt, um vorgeschriebenen städtischen, staatlichen oder politischen Protokollen zu folgen, und die keine Kranzniederlegungen und Gedenktafeln generiert? Eine Frage der urbanen und kulturellen Praxis. Die Behauptung „Antifaschismus taugt nicht als Denkmal“ entstand beim Hören einer Radiosendung über das Werk des jüdischen Dichters Paul Celan, das von seiner unmittelbaren Erfahrung mit Gewalt, Verfolgung und Tod im Faschismus geprägt ist. Sie ist ein dialektischer Blick auf eine aktuelle Gedenkkultur, die mit repräsentativen Gesten an offiziellen Gedenktagen medienwirksame Bilder produziert.
Das raumgreifende Banner zitiert visuell die offiziellen politischen Losungen der DDR im öffentlichen Raum, die auf überdimensionierten großen Transparenten einen politisch sanktionierten Antifaschismus propagierten. Inhaltlich thematisiert der Slogan in seiner Ambivalenz Widersprüche von Erinnerungspolitik. Der Satz auf dem 30m langen Banner ist in der Schrift Super Grotesk gesetzt. 1928 wurde sie von Arno Drescher entworfen. Er war 1940–45 auch Rektor der Leipziger Kunsthochschule. Die Super Grotesk war zusammen mit der Maxima eine der am häufigsten verwendeten Schriften in der DDR. Mit ihr wurden im „Neuen Deutschland“ – dem „Zentralorgan der SED“ von 1946 bis 1989 – die täglichen politischen Losungen des real existierenden Sozialismus gesetzt.
Der öffentliche Raum über dem Karl-Heine-Kanal am Stelzenhaus im ehemaligen Industriegebiet Leipzig-Plagwitz wird vom Slacknetz Leipzig e.V. für Balanceakte genutzt. An den Wochenenden kann man die Slackliner dort beim Training sehen und über ihre Kunststücke staunen. Diese urbane Praxis, den städtischen Raum spielerisch zu nutzen, hat auch für Vorbeigehende Unterhaltungswert. Die Aktivierung des Banners in diesem Kontext bricht mit Gesten von Demonstrationen und politischen Forderungen und gewinnt durch die artistische Leichtigkeit der Bewegungen auf der Slackline.
Das Stelzenhaus selbst ist als Industrie-Denkmal auch ein Erinnerungsort an die Zwangsarbeit während der NS-Zeit. Um die Kapazitäten für die Rüstungsproduktion der Verzinkerei Grohmann & Frosch zu erweitern, wurde im Industriegebiet Leipzig Plagwitz eine neue Halle gebraucht. Aus Platzmangel entstand 1937–39 die auf Stelzen errichtete Lagerhalle am ausgehobenen Karl-Heine-Kanal. Das Unternehmen produzierte im 2. Weltkrieg unter anderem das Panzerschutzschild „Siegfried“. Für die Produktion wurden Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene eingesetzt. Das titelgebende Zitat des Historikers Eike Geisel kommentiert Formen des Gedenkens in Deutschland als „höchste Form des Vergessens“ und thematisiert Widersprüche und Instrumentalisierungen von Erinnerungskultur.
aufknoten/aufmerken, sich wieder verbinden
Angelika Waniek und Inga Martel
Performance / 16. März + 24. April
aufknoten/aufmerken, sich wieder verbinden ist eine Recherche zur Zeitzeugenschaft im öffentlichen Raum, eine performative Situation in der Nachbarschaft von Pflanzen. Dabei blickt die Performerin Angelika Waniek zusammen mit Inga Martel, Künstlerin und somatisch Forschende, auf individuelle Lebensgeschichten, subjektive Erfahrungen, Pflanzen und ihre Spuren. Die Zeit, die bezeugt wird, ist die des Nationalsozialismus. Die Zeug*innen sind diejenigen, gegen die sich die Gewalt im Nationalsozialismus richtete, aber auch Bäume als vermeintlich stumme Zeugen, denen sich Waniek und Martel zuneigen. Zwei davon stehen in unmittelbarer Nähe des Kunstraums IDEAL und der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Orte, denen die Künstlerinnen verbunden sind.
16.März // 16.30 Uhr Kunstraum IDEAL
aufknoten, sich wieder verbinden
Der Kunstraum IDEAL befindet sich auf dem ehemaligen Werksgelände des Unternehmens Clemens Humann. Eine Metallfabrik, die während der Zeit des Zweiten Weltkrieges Zuliefererbetrieb für die Rüstungsindustrie war, besonders für den Flugzeugbau. Dabei waren auch Zwangsarbeiter:innen im Einsatz, vor allem aus der Sowjetunion, Frankreich, Spanien, Estland, Belgien, Italien, Kroatien und dem Protektorat Böhmen und Mähren. Quelle: Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig (www.zwangsarbeit-in-leipzig.de/karte)
24.April // 17 Uhr Hochschule für Grafik und Buchkunst
aufmerken, sich wieder verbinden
Die Performance in der Nähe der HGB findet statt in Kooperation mit der Ausstellung “Partizan★ke Art – Die Kunst des weiblichen Widerstands in Jugoslawien und Kärnten”, die den Fokus auf den bis heute wenig sichtbaren weiblichen Widerstand gegen die deutsche Besatzungsgewalt und die Achsenmächte in Jugoslawien legt.
Book to head
Max Baitinger
Billboard
Max Baitingers Comic ist eine erzählerische Dekonstruktion einiger Sekunden im Leben Victor Klemperers: In Dresden schlägt ihm Johannes Clemens, Mitglied der SS, das Buch „Der Mythos des 20. Jahrhunderts“ auf den Kopf. Die Symbolik, dass ein jüdischer Professor von einem SS-Mitglied mit der Nazi-Ideologie geschlagen wird, wird auf den dreißig Seiten des Comics auseinandergenommen. Baitinger folgt erzählerischen Fäden, die durch das Leben des Protagonisten führen, um einer stumpfen, aber aussagekräftigen Anekdote Tiefe zu verleihen. Für den Ideal Art Space wurde das ursprüngliche Heft von 2017 zu einer Billboard-Collage neugeordnet. Victor Klemperer (1881 – 1960) ist bekannt für seine Tagebücher über seine Jahre im Nationalsozialismus, die er mit seiner nicht-jüdischen Frau Eva in Dresden verbrachte.
geb. 7. Oktober 1977, Alexandria, gest. 1. Juli 2009, Dresden (ein Kommentar)
Susanne Keichel
Posterserie im Stadtraum
Die Fotografin Susanne Keichel zeigt in dieser Arbeit aus der Perspektive einer Anwesenden die Gedenkfeiern für die Ägypterin Marwa Ali El-Sherbini. Sie war eine ägyptische Handballnationalspielerin und Pharmazeutin, die als Zeugin eines Strafprozesses aus islam- und ausländerfeindlichen Motiven im Jahr 2009 in Dresden im Gerichtssaal von dem Angeklagten des Prozesses erstochen wurde. Der Gewaltakt im Gerichtssaal begründete eine Diskussion um die Sicherheit an den Gerichten und eine Gedenkkultur für das Opfer in Dresden. Die schnappschussartigen Bildausschnitte bewegen sich ästhetisch zwischen Privataufnahme und Pressefoto und erinnern daran, dass es sich hier nicht um Fiktion handelt. Sie dokumentieren Momente, ein Gefühl der Betroffenheit und Ohnmacht angesichts einer Tat, die vor den Augen aller stattfand.
Die fotografische Arbeit wurde für diese Ausstellung als Plakatedition bearbeitet und ist neben der Präsentation am IDEAL auch im Stadtraum verteilt.
Mapping a Memory
Mandy Gehrt
Gespräch über ein künstlerisches Archivprojekt / 26. April
Mandy Gehrt setzt sich in ihrer Arbeit mit Formen des Erinnerns und Bewahrens, Kulturen des Gedenkens sowie der Konstruktion von Geschichte auseinander. Sie interessiert sich sowohl für private Sammlungen und Erzählungen als auch für Archivierungspraktiken und kollektive Gedenkrituale. Mit ihrem künstlerischen Archivprojekt verfolgt sie das Ziel, die individuellen Erinnerungen ungarisch-jüdischer Holocaustüberlebender zu kartieren, die im KZ-Außenlager von Buchenwald in Markkleeberg (Landkreis Leipzig) zur Zwangsarbeit verpflichtet wurden.
In dem Gespräch wird Mandy Gehrt Einblicke in ihre Recherchen in Deutschland, Ungarn und New York geben, bei denen sie die Lebenswege der Überlebenden bis nach New York dokumentierte und Verbindungen zu Archiven und Museen untersuchte. In diesem Zusammenhang besuchte sie auch die Familien der Überlebenden und erforschte deren individuelle Erinnerungspraxen.
Beteiligte
Ute Richter, *1964 in Dresden, arbeitet als Bildende Künstlerin interdisziplinär mit Installation, Video, urbaner Intervention und Zeichnung. Ihre künstlerischen Recherchen entwickelt sie im Kontext von Alltag, Architektur, urbanem Raum und Erinnerung. Ihr Werk umfasst ortsspezifische Installationen im öffentlichen Raum. Die künstlerische Arbeit begreift sie als gesellschaftliches Handeln. Von 1986–91 studierte sie an der HfBK Dresden, lebte von 1992–98 in Paris, seit 2005 in Leipzig.
www.ute-richter.de
Angelika Waniek, bildende Künstlerin und Performerin lebt und arbeitet in Leipzig. Sie blickt auf eine langjährige künstlerische Auseinandersetzung und Erarbeitung von ortsspezifischen performativen Situationen u.a. zu deutsch-deutschen, auch transnationalen Themen der Erinnerungskultur, Gedenk- und Heilungsprozessen und darin die Verbindungen zwischen gesellschaftlichen und biografischen Ereignissen und deren Bewahrung in Archiven. Lehraufträge u.a. an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (Leipzig), Burg Giebichenstein (Halle), Muthesius Kunsthochschule (Kiel).
www.lea.hotglue.me/
Juliane Jaschnow ist Künstlerin und Filmemacherin. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind zeitgenössische und historische Bildpolitiken sowie kollektive Narrative, Erinnerungsprozesse und deren identitätsstiftende Dimension. Sie hatte Residenzaufenthalte an der Cité internationale des arts Paris und Akademie Schloss Solitude, war Teilnehmerin an der PMMC/Lab der Werkleitz Gesellschaft. Sie ist Teil der Filmischen Initiative Leipzig (FILZ).
www.julianejaschnow.de/
Ipke Starke studierte Musik in Leipzig und Paris und arbeitete anschließend als Assistent für computergestützte Komposition am IRCAM in Paris. Seit 2000 Professur für Tonsatz und Elektroakustische Komposition an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Von 2016 bis 2024 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Elektroakustische Musik (DEGEM). Künstlerische Arbeiten für instrumentale Besetzungen, elektroakustische Medien, genreüberschreitende und interdisziplinäre Projekte.
Max Baitinger wurde 1982 in Penzberg geboren. Er absolvierte eine Schreinerausbildung und studierte Illustration an der HGB Leipzig. Er war Mitorganisator des Internationalen Comic- und Grafikfestivals „The Millionaires Club“ und arbeitet als freischaffender Illustrator, verfasst Graphic Novels und Zines. Seine Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Für „Sibyl-la“ wurde ihm der Comicbuchpreis der Berthold Leibinger Stiftung verliehen.
www.maxbaitinger.com
Susanne Keichel studierte nach einer Ausbildung zur Fotografin bei Stefan Thurmann in Hamburg, an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und schloss ihr Studium als Meisterschülerin bei Prof. Tina Bara ab. Gesellschaftliche und politische Entwicklungen und deren Auswirkungen über längere Zeiträume stehen im Zentrum von Susanne Keichels Arbeit. Ein starker Fokus liegt dabei auf dem Weggehen und Ankommen von Menschen in einer globalisierten Welt und auf der sozialen Ungleichheit, die unsere Gesellschaft reproduziert.
https://www.susannekeichel.de/
Inga Martel, bildende Künstlerin, und Performerin lebt und arbeitet in Leipzig und in Island. Als Somatic Movement Educator für Body-Mind Centering® arbeitet sie im Bereich Körperforschung und somatischer Erfahrbarkeit.
Als Gründerin des Laboratoriums für Somatisches Erforschen: Einen Raum für potenziale Entfaltung, Embodyment und Achtsamkeit, vermittelt sie Ursang — intuitives Tönen, begleitet und verbindet Menschen mit ihren Körper- und Stimmlandschaften.
Mandy Gehrt erforscht in ihrer künstlerischen Arbeit Prozesse des Erinnerns und Bewahrens sowie die Konstruktion von Geschichte. Sie interessiert sich für private und kollektive Narrative, Archivierungspraktiken und Gedenkkulturen. Dabei verbindet sie persönliche Erzählungen mit materiellen und immateriellen Spuren der Vergangenheit, untersucht, wie Erinnerung durch Objekte, Dokumente und Rituale geformt wird, und hinterfragt gesellschaftliche Mechanismen des Gedenkens.
Der Slacknetz Leipzig e.V. vereint engagierte Sportlerinnen und Sportler mit einer gemeinsamen Leidenschaft für das Slacklinen, insbesondere das anspruchsvolle Highlinen in Parks, urbanen Räumen und natürlichen Landschaften. Der Verein fördert den Sport in Leipzig, Deutschland und international und engagiert sich für dessen nachhaltige Entwicklung.
www.slacknetzleipzig.de
Die Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig erinnert an die Opfer und Folgen des NS-Zwangsarbeitseinsatzes. Sie dient als Anlaufstelle für Betroffene, erforscht unbeleuchtete Aspekte und sammelt historische Zeugnisse. Öffentliche Veranstaltungen, Führungen, Stadtteilrundgänge und Bildungsprogramme ergänzen die Ausstellung am Standort der HASAG, Sachsens größtem Rüstungsbetrieb.
_____________
Das dreiteilige Ausstellungsprojekt ist in enger Zusammenarbeit von Ute Richter mit Angelika Waniek, Clara Hofmann und Gregor Peschko entwickelt worden. Die Grafik des Projektes und das Banner wurden mit den Grafiker:innen Nelly Nakahara und Gerrit Brocks umgesetzt.
Mit freundlicher Unterstützung von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, dem Kulturamt der Stadt Leipzig, der Stiftung Kunstfonds, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und dem sächsischen Förderprogramm Sehnsucht nach Freiheit. Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.