Veranstaltungsprogramm:
2 Tonnen Kalkstein
Neubetrachtung des Denkmals am Markt
17.05. – 13.07.2025












Sonntag 18.05. / 16 Uhr
Nachbarschaftsforum am Denkmal I: Bestandsaufnahme – Was denkt Ihr zum Denkmal am Neustädter Markt?
mit de Künstler:innen Susanne Schuda, Nicole Six & Paul Petritsch
Sonntag 22.06.2025 / 16:00 Uhr
Nachbarschaftsforum am Denkmal II: Welche Zukunft hat das Denkmal?
mit Pfarrer Stief, Julia Kurz (Programm Stadtkuratorin Leipzig), Dr. Ralf Eschenbrücher(Denkmalamt), Dr. Urte Evert (Museen der Zitadelle Spandau), Martha Schwindling und Marlene Oeken



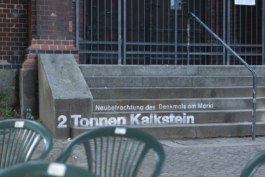










Samstag, 14.06. / 18 Uhr
„Heritage is the Answer! But what was the Question?“ – Museen, Denkmalpflege und das Recht auf Erbe in der Migrationsgesellschaft
Vortrag von Dr. Gülşah Stapel und anschließendes Gespräch mit Anike Joyce Sadiq
Was bedeutet es, kulturelles Erbe in einer Gesellschaft zu denken, die von Vielfalt, Menschenrechten und dem Streben nach sozialer Gerechtigkeit geprägt ist? Warum ist es wichtig, die Aushandlungsprozesse rund um kulturelles Erbe nicht nur als kulturpolitisches, sondern auch als soziales Thema zu begreifen? Wer entscheidet darüber, was bewahrt wird – und wessen Geschichte unsichtbar bleibt?
Der Vortrag greift zentrale Überlegungen aus Gülşah Stapels Buch „Recht auf Erbe in der Migrationsgesellschaft“ auf und fragt nach dem Sinn und den Spannungen öffentlicher Erinnerungsverständnisse. Im Fokus stehen die Kritik an tradierten Erbekonzepten, hegemoniale Ausschlüsse im kulturellen Gedächtnis – sowie die Suche nach Strategien, wie diese überwunden werden können, ohne in ein neues Konkurrenzdenken um das „richtige“ Erinnern zu verfallen.
Anhand des aktuellen Streits um das Soldatendenkmal in Leipzig wird exemplarisch gezeigt, wie konflikthaft und politisch aufgeladen der Umgang mit Erinnerung im öffentlichen Raum sein kann – und welche Fragen sich daraus für eine gerechte und inklusive Erinnerungskultur ableiten lassen. Wie kann öffentliches Erinnern gestaltet werden, ohne auf Prinzipien von Ausschluss und Wettbewerb zu setzen? Und wie lassen sich politische und kulturelle Praktiken des Erinnerns gerechter, vielstimmiger und inklusiver entwickeln?
Dr. Gülşah Stapel ist Co-Gründerin und Co-Direktorin des TAM Museums zu 500 Jahren deutsch-türkeistämmigen, transkulturellen Geschichten. Sie ist zudem Teilzeitkuratorin für Outreach Prozesse bei der Stiftung Berliner Mauer und im Vorstand von ICOM Deutschland. Die Hanse-Bosporus-Deutsche ist Expertin für urbanes Kulturerbe und Erinnerungspolitik. Sie ist Dipl.-Ing. für Stadt- und Regionalplanung und verfasste ihre Dissertation Identität und Erbe im Rahmen des DFG Graduiertenkollegs an der TU-Berlin. Ihre Publikation „Recht auf. Erbe in der Migrationsgesellschaft. Eine Studie an Erinnerungsorten türkeistämmiger Berliner:innen“ erschien 2023 im Urbanophil Verlag.
Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit Stadtkuratorin Leipzig
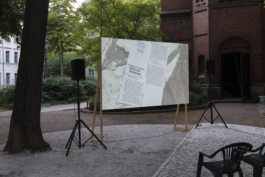







Sonntag 01.06. / 20:30 Uhr
Kino am Denkmal:
The Halfmoon Files / Philip Scheffner
D 2007, 87 min
„Es war einmal ein Mann.
Er geriet in den europäischen Krieg.
Deutschland nahm diesen Mann gefangen.
Er möchte nach Indien zurückkehren.
Wenn Gott gnädig ist, wird er bald Frieden machen.
Dann wird dieser Mann von hier fortgehen."
Knisternd verklingen die Worte von Mall Singh, gesprochen in einen Phonographentrichter am 11. Dezember 1916 in der Stadt Wünsdorf bei Berlin. 90 Jahre später ist Mall Singh eine Nummer auf einer alten Schellackplatte in einem Archiv, eine unter Hunderten von Stimmen von Kolonialsoldaten des 1. Weltkrieges.
Die Aufnahmen entstanden in einer einmaligen Allianz aus Militär, Wissenschaft und Unterhaltungsindustrie. Philip Scheffner folgt in seiner experimentellen Spurensuche „The Halfmoon Files“ diesen Stimmen an den Ort ihrer Aufnahme. Wie in einem Memoryspiel, das bis zum Ende unvollständig bleibt, deckt er Bilder und Töne auf, in denen die Geister der Vergangenheit zum Leben erwachen. Diejenigen, die den Aufnahmeknopf drückten an ihren Phonographen, an ihren Foto- und Filmkameras, haben die offizielle Geschichte geschrieben. Mall Singh und die anderen Kriegsgefangenen aus dem Halbmondlager sind aus dieser Geschichte verschwunden. Ihre Geister scheinen mit dem Filmemacher zu spielen, ihm aufzulauern. Sie folgen ihm auf seinem Weg, die Stimmen in ihre Heimat zurückzubringen. Doch die Handlung der Geschichte entgleitet dem Erzähler. Und die Geister lassen sich nicht vertreiben.
Der historische Hintergrund des Films: Während des Ersten Weltkriegs wird der Islam Teil der deutschen Kriegsstrategie: Mit dem neuen Bündnispartner, dem Osmanischen Reich ruft Deutschland 1914 zum „Djihad“ auf, um muslimische Kolonialsoldaten zum Seitenwechsel zu bewegen. In Sonderlagern wie dem Halbmondlager Wünsdorf werden gefangene Muslime interniert, um sie für den Krieg gegen die Kolonialmächte zu gewinnen. Gleichzeitig rücken sie ins Interesse der Wissenschaft: Die 1915 gegründete Phonographische Kommission fertigt umfangreiche Sprachaufnahmen an, die heute das Berliner Lautarchiv bilden. Diese historischen Tonaufnahmen sind Ausgangspunkt des Projekts The Halfmoon Files.
Samstag, 21.06. / 20:30 Uhr
Kino am Denkmal
Le soldat mourrant des Milles / Maya Schweizer / 9:30 min / 2014 / OmdU
Der Film „Der sterbende Soldat von Les Milles“ beobachtet sowohl die Gedenkstätte Le Camp des Milles – ein ehemaliges Internierungslager des Zweiten Weltkriegs in einer alten Ziegelei in Aix-en-Provence – als auch das Denkmal eines sterbenden Soldaten, der sich verwundet auf seine mit Munition gefüllten Taschen stützt. Das Denkmal ist den toten Soldaten der beiden Weltkriege und des Algerienkriegs gewidmet.
Die Kamera bewegt sich um den Soldaten und den Platz herum. Sie nimmt den Rhythmus des Pétanque-Spiels zu seinen Füßen auf und zeigt den Betrachtenden die beiden Orte des Gedenkens in ihrem aktuellen Erscheinungsbild.
„Levitate“ / Ivan Argote / 25 Min / 2022 / OmeU
„Levitate“ beschäftigt sich mit der Rolle von Denkmälern in europäischen Städten. Argote kritisiert sie als Symbole kolonialer Gewalt in großangelegten Performances. Der Film zeigt Aktionen in Rom, Madrid und Paris, mit denen er auf die gewaltvolle Geschichte von historischen Denkmälern hinweist und sie buchstäblich demontiert. Zugleich dient er der autobiografischen Reflexion des Künstlers über seine Ankunft in Europa. Argote fordert uns auf, sich eine alternative Zukunft für gemeinschaftlich genutzten Raum vorzustellen.
Das andere Denkmal / Nicole Six und Paul Petritsch /35 min / 2025 / de
Durch Zufall stießen Nicole Six und Paul petritsch auf eine der breiten Öffentlichkeit unbekannte Skulptur: Die Figur eines Partisanen oder „Fackelträgers“ – die Meinungen gehen auseinander – steht seit der Eröffnung des Kulturhauses des Slowenischen Kulturvereins Radsberg / Slovensko prosvetno društvo Radiše im Jahr 1979 im Keller des Hauses. Es wird erzählt, die Skulptur sei „immer da gewesen“. Wie sie ins Getränkelager des Kulturhauses kam, ist bis heute ungeklärt. Fest steht: Der Bildhauer Marijan Matijević, der auch für die Figurengruppe am Peršmanhof verantwortlich ist, schuf sie Ende der 1940er-Jahre.











17.05. 18:00 Uhr
Performance
Gute Verlierer / Susanne Schuda
Kein Lernen aus Fehlern.
Keine Entschuldigung, keine Wiedergutmachung.
Keine andere Perspektive.
Einfach nur verlieren.
Die Einsamkeit des Verlierers mit den anderen Verlierern teilen, ohne jeden Trost, ohne jede gottverdammte Heilung, noch nicht mal die Labsal der Verdrängung.
Die Hochgradigkeit des tiefsten Falls unter Beweis stellen und auch dabei verlieren.
Verlierer sind Betrüger.
Hoffnung ist Verrat.
Schudini The Sensitive – die Therapeutin des kollektiven Unbewusstseins, steigt aufs Siegertreppchen und schaut dann mal weiter…
Das Projekt wurde mit Fördermitteln der Stiftung Kunstfonds, die Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie des Kulturamtes der Stadt Leipzig realisiert.

Veranstaltungsprogramm:
2 Tonnen Kalkstein
Neubetrachtung des Denkmals am Markt
17.05. – 13.07.2025












Sonntag 18.05. / 16 Uhr
Nachbarschaftsforum am Denkmal I: Bestandsaufnahme – Was denkt Ihr zum Denkmal am Neustädter Markt?
mit de Künstler:innen Susanne Schuda, Nicole Six & Paul Petritsch
Sonntag 22.06.2025 / 16:00 Uhr
Nachbarschaftsforum am Denkmal II: Welche Zukunft hat das Denkmal?
mit Pfarrer Stief, Julia Kurz (Programm Stadtkuratorin Leipzig), Dr. Ralf Eschenbrücher(Denkmalamt), Dr. Urte Evert (Museen der Zitadelle Spandau), Martha Schwindling und Marlene Oeken



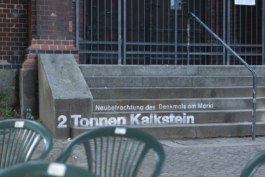










Samstag, 14.06. / 18 Uhr
„Heritage is the Answer! But what was the Question?“ – Museen, Denkmalpflege und das Recht auf Erbe in der Migrationsgesellschaft
Vortrag von Dr. Gülşah Stapel und anschließendes Gespräch mit Anike Joyce Sadiq
Was bedeutet es, kulturelles Erbe in einer Gesellschaft zu denken, die von Vielfalt, Menschenrechten und dem Streben nach sozialer Gerechtigkeit geprägt ist? Warum ist es wichtig, die Aushandlungsprozesse rund um kulturelles Erbe nicht nur als kulturpolitisches, sondern auch als soziales Thema zu begreifen? Wer entscheidet darüber, was bewahrt wird – und wessen Geschichte unsichtbar bleibt?
Der Vortrag greift zentrale Überlegungen aus Gülşah Stapels Buch „Recht auf Erbe in der Migrationsgesellschaft“ auf und fragt nach dem Sinn und den Spannungen öffentlicher Erinnerungsverständnisse. Im Fokus stehen die Kritik an tradierten Erbekonzepten, hegemoniale Ausschlüsse im kulturellen Gedächtnis – sowie die Suche nach Strategien, wie diese überwunden werden können, ohne in ein neues Konkurrenzdenken um das „richtige“ Erinnern zu verfallen.
Anhand des aktuellen Streits um das Soldatendenkmal in Leipzig wird exemplarisch gezeigt, wie konflikthaft und politisch aufgeladen der Umgang mit Erinnerung im öffentlichen Raum sein kann – und welche Fragen sich daraus für eine gerechte und inklusive Erinnerungskultur ableiten lassen. Wie kann öffentliches Erinnern gestaltet werden, ohne auf Prinzipien von Ausschluss und Wettbewerb zu setzen? Und wie lassen sich politische und kulturelle Praktiken des Erinnerns gerechter, vielstimmiger und inklusiver entwickeln?
Dr. Gülşah Stapel ist Co-Gründerin und Co-Direktorin des TAM Museums zu 500 Jahren deutsch-türkeistämmigen, transkulturellen Geschichten. Sie ist zudem Teilzeitkuratorin für Outreach Prozesse bei der Stiftung Berliner Mauer und im Vorstand von ICOM Deutschland. Die Hanse-Bosporus-Deutsche ist Expertin für urbanes Kulturerbe und Erinnerungspolitik. Sie ist Dipl.-Ing. für Stadt- und Regionalplanung und verfasste ihre Dissertation Identität und Erbe im Rahmen des DFG Graduiertenkollegs an der TU-Berlin. Ihre Publikation „Recht auf. Erbe in der Migrationsgesellschaft. Eine Studie an Erinnerungsorten türkeistämmiger Berliner:innen“ erschien 2023 im Urbanophil Verlag.
Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit Stadtkuratorin Leipzig
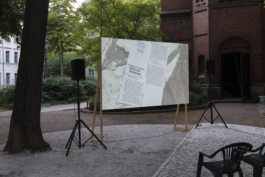







Sonntag 01.06. / 20:30 Uhr
Kino am Denkmal:
The Halfmoon Files / Philip Scheffner
D 2007, 87 min
„Es war einmal ein Mann.
Er geriet in den europäischen Krieg.
Deutschland nahm diesen Mann gefangen.
Er möchte nach Indien zurückkehren.
Wenn Gott gnädig ist, wird er bald Frieden machen.
Dann wird dieser Mann von hier fortgehen."
Knisternd verklingen die Worte von Mall Singh, gesprochen in einen Phonographentrichter am 11. Dezember 1916 in der Stadt Wünsdorf bei Berlin. 90 Jahre später ist Mall Singh eine Nummer auf einer alten Schellackplatte in einem Archiv, eine unter Hunderten von Stimmen von Kolonialsoldaten des 1. Weltkrieges.
Die Aufnahmen entstanden in einer einmaligen Allianz aus Militär, Wissenschaft und Unterhaltungsindustrie. Philip Scheffner folgt in seiner experimentellen Spurensuche „The Halfmoon Files“ diesen Stimmen an den Ort ihrer Aufnahme. Wie in einem Memoryspiel, das bis zum Ende unvollständig bleibt, deckt er Bilder und Töne auf, in denen die Geister der Vergangenheit zum Leben erwachen. Diejenigen, die den Aufnahmeknopf drückten an ihren Phonographen, an ihren Foto- und Filmkameras, haben die offizielle Geschichte geschrieben. Mall Singh und die anderen Kriegsgefangenen aus dem Halbmondlager sind aus dieser Geschichte verschwunden. Ihre Geister scheinen mit dem Filmemacher zu spielen, ihm aufzulauern. Sie folgen ihm auf seinem Weg, die Stimmen in ihre Heimat zurückzubringen. Doch die Handlung der Geschichte entgleitet dem Erzähler. Und die Geister lassen sich nicht vertreiben.
Der historische Hintergrund des Films: Während des Ersten Weltkriegs wird der Islam Teil der deutschen Kriegsstrategie: Mit dem neuen Bündnispartner, dem Osmanischen Reich ruft Deutschland 1914 zum „Djihad“ auf, um muslimische Kolonialsoldaten zum Seitenwechsel zu bewegen. In Sonderlagern wie dem Halbmondlager Wünsdorf werden gefangene Muslime interniert, um sie für den Krieg gegen die Kolonialmächte zu gewinnen. Gleichzeitig rücken sie ins Interesse der Wissenschaft: Die 1915 gegründete Phonographische Kommission fertigt umfangreiche Sprachaufnahmen an, die heute das Berliner Lautarchiv bilden. Diese historischen Tonaufnahmen sind Ausgangspunkt des Projekts The Halfmoon Files.
Samstag, 21.06. / 20:30 Uhr
Kino am Denkmal
Le soldat mourrant des Milles / Maya Schweizer / 9:30 min / 2014 / OmdU
Der Film „Der sterbende Soldat von Les Milles“ beobachtet sowohl die Gedenkstätte Le Camp des Milles – ein ehemaliges Internierungslager des Zweiten Weltkriegs in einer alten Ziegelei in Aix-en-Provence – als auch das Denkmal eines sterbenden Soldaten, der sich verwundet auf seine mit Munition gefüllten Taschen stützt. Das Denkmal ist den toten Soldaten der beiden Weltkriege und des Algerienkriegs gewidmet.
Die Kamera bewegt sich um den Soldaten und den Platz herum. Sie nimmt den Rhythmus des Pétanque-Spiels zu seinen Füßen auf und zeigt den Betrachtenden die beiden Orte des Gedenkens in ihrem aktuellen Erscheinungsbild.
„Levitate“ / Ivan Argote / 25 Min / 2022 / OmeU
„Levitate“ beschäftigt sich mit der Rolle von Denkmälern in europäischen Städten. Argote kritisiert sie als Symbole kolonialer Gewalt in großangelegten Performances. Der Film zeigt Aktionen in Rom, Madrid und Paris, mit denen er auf die gewaltvolle Geschichte von historischen Denkmälern hinweist und sie buchstäblich demontiert. Zugleich dient er der autobiografischen Reflexion des Künstlers über seine Ankunft in Europa. Argote fordert uns auf, sich eine alternative Zukunft für gemeinschaftlich genutzten Raum vorzustellen.
Das andere Denkmal / Nicole Six und Paul Petritsch /35 min / 2025 / de
Durch Zufall stießen Nicole Six und Paul petritsch auf eine der breiten Öffentlichkeit unbekannte Skulptur: Die Figur eines Partisanen oder „Fackelträgers“ – die Meinungen gehen auseinander – steht seit der Eröffnung des Kulturhauses des Slowenischen Kulturvereins Radsberg / Slovensko prosvetno društvo Radiše im Jahr 1979 im Keller des Hauses. Es wird erzählt, die Skulptur sei „immer da gewesen“. Wie sie ins Getränkelager des Kulturhauses kam, ist bis heute ungeklärt. Fest steht: Der Bildhauer Marijan Matijević, der auch für die Figurengruppe am Peršmanhof verantwortlich ist, schuf sie Ende der 1940er-Jahre.











17.05. 18:00 Uhr
Performance
Gute Verlierer / Susanne Schuda
Kein Lernen aus Fehlern.
Keine Entschuldigung, keine Wiedergutmachung.
Keine andere Perspektive.
Einfach nur verlieren.
Die Einsamkeit des Verlierers mit den anderen Verlierern teilen, ohne jeden Trost, ohne jede gottverdammte Heilung, noch nicht mal die Labsal der Verdrängung.
Die Hochgradigkeit des tiefsten Falls unter Beweis stellen und auch dabei verlieren.
Verlierer sind Betrüger.
Hoffnung ist Verrat.
Schudini The Sensitive – die Therapeutin des kollektiven Unbewusstseins, steigt aufs Siegertreppchen und schaut dann mal weiter…
Das Projekt wurde mit Fördermitteln der Stiftung Kunstfonds, die Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie des Kulturamtes der Stadt Leipzig realisiert.
